Das Pariser Abkommen und die „freiwillige“ Schwäche
Das 2015 verabschiedete Pariser Abkommen setzt ein klares, aber nicht verbindliches globales Ziel: den Temperaturanstieg deutlich unter 2 °C (idealerweise nahe 1,5 °C) über dem vorindustriellen Niveau zu halten. Es fordert die Staaten außerdem auf, wissenschaftlich fundierte Wege zu Netto-Null-Emissionen auf nationaler und globaler Ebene zu entwickeln. Die Staaten sind verpflichtet, Fünfjahres-Aktionspläne vorzulegen und zu aktualisieren sowie transparent über ihre Fortschritte zu berichten.

Das Problem des Pariser Abkommens von 2015 liegt jedoch in seinem grundlegenden „freiwilligen“ Charakter – einem unverbindlichen Versprechen der Länder, ihre Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Und in einer Welt, die nach wie vor so gespalten ist, ist „freiwillig“ ein Luxus, der oft endlose Debatten auslöst.
Dies spiegelt sich unter anderem darin wider, dass bis Ende September 2025 nur 64 Vertragsparteien ihre national festgelegten Beiträge (NDCs) eingereicht hatten, obwohl das Pariser Abkommen deren Einreichung bis Februar 2025 vorschrieb. Das Fehlen starker Zusagen von großen Emittenten hat die Wirksamkeit des Mechanismus zur Steigerung der Klimaambitionen des Pariser Abkommens erheblich beeinträchtigt.
Die Bekämpfung des Klimawandels ist zu dringlich.
Inzwischen spürt nicht nur die Staats- und Regierungschefs, die an der COP30 teilnehmen, sondern auch jeder normale Mensch auf diesem Planeten die gravierenden Auswirkungen des Klimawandels.
Laut den Vereinten Nationen war 2024 weltweit das wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen. Die Durchschnittstemperaturen lagen fast 1,5 °C über dem vorindustriellen Niveau, und der Januar 2025 war der wärmste Monat seit Beginn der Aufzeichnungen. Diese alarmierende Realität wurde durch eine Reihe von Klimakatastrophen belegt, die sich in den letzten Jahren weltweit ereignet haben und immer schwerwiegender werden.
Statistiken zeigen außerdem, dass trotz erheblicher Fortschritte seit dem Pariser Abkommen, die vor allem dem rasanten Wachstum billiger erneuerbarer Energien zu verdanken sind, die globalen Treibhausgasemissionen weiter steigen und im Jahr 2024 einen Rekordwert von 57,7 GtCO2e erreichen – ein Anstieg um 2,3 % gegenüber 2023.
Aktuelle Szenarien, die auf der vollständigen Umsetzung aller jüngsten Verpflichtungen basieren, deuten weiterhin auf einen prognostizierten globalen Temperaturanstieg von 2,3 °C bis 2,5 °C bis zum Ende des Jahrhunderts hin. Die derzeitige Politik hingegen lässt die Welt auf eine Erwärmung von 2,8 °C zusteuern – eine Katastrophe für die gesamte Menschheit.
US-Rückzug und unambitionierte Verpflichtungen
In diesem Zusammenhang ist ein Konsens zwischen Ländern und Parteien die wichtigste Voraussetzung für die Bewältigung dieser dringenden globalen Krise. Allerdings ist ein Konsens in der heutigen Welt auch ein Luxus.
Das besorgniserregendste Ereignis der jüngeren Geschichte ist der Austritt der USA aus dem Pariser Abkommen (das im Januar 2026 in Kraft tritt). Dies ist nicht nur ein Schlag für den Geist der globalen Zusammenarbeit. Analysen haben gezeigt, dass dieser Austritt den Fortschritt bei der Eindämmung der globalen Erwärmung um etwa 0,1 °C zunichtemachen wird.
Nicht nur die USA haben ihre Teilnahme zurückgezogen, auch Chinas Zusage, die CO₂-Emissionen bis 2035 um 7 bis 10 Prozent gegenüber dem Höchststand zu senken, wurde als zu schwach kritisiert. Zudem haben Verzögerungen und wenig überzeugende Zusagen großer Emittenten wie der Europäischen Union die Aussichten auf einen Durchbruch auf der COP30 erheblich gedämpft.
Es ist außerdem wichtig zu erwähnen, dass der Erfolg der COP30 maßgeblich von der Umsetzung des neuen Gemeinsamen Quantitativen Ziels für Klimafinanzierung (NCQG) abhängt. Ziel ist es, bis 2035 jährlich mindestens 300 Milliarden US-Dollar für Entwicklungsländer zu mobilisieren und insgesamt 1,3 Billionen US-Dollar anzustreben. Dieses Ziel scheint jedoch noch in weiter Ferne zu liegen.
Hoffnung durch das Urteil des IGH
Glücklicherweise gibt es in diesem düsteren Umfeld noch Hoffnungsschimmer. Vor allem gibt es weiterhin viele Länder und globale Organisationen, die den Klimawandel entschlossen bekämpfen und auf der COP30 starke Verpflichtungen eingehen.
Darüber hinaus veröffentlichte der Internationale Gerichtshof (IGH) im Juli 2025 nach einer mehrjährigen Kampagne, die von Vanuatu initiiert und von vielen Ländern unterstützt wurde, ein beispielloses und einstimmiges Gutachten zu den Verpflichtungen der Staaten im Zusammenhang mit dem Klimawandel.
Der Internationale Gerichtshof (IHK) hat entschieden, dass Staaten die Pflicht haben, die Umwelt vor Treibhausgasemissionen zu schützen und die dafür notwendigen Maßnahmen zu ergreifen. Das Urteil bestätigte zudem, dass die Begrenzung der globalen Erwärmung auf 1,5 Grad Celsius ein erstrebenswertes Ziel ist und nicht länger „freiwillig“ bleibt.
Die Einigung auf Mechanismen zur Gewährleistung einer effektiven Durchsetzung der Urteile des Internationalen Gerichtshofs hat auf der COP30 höchste Priorität und ist eine lang erwartete Aufgabe. Gelingt dies, könnte das „Freiwilligkeitsparadoxon“ , das im Pariser Abkommen von 2015 seit zehn Jahren besteht, aufgelöst werden.
Quelle: https://congluan.vn/thoa-thuan-paris-2015-tron-10-nam-va-lieu-thuoc-thu-tai-cop30-10316792.html





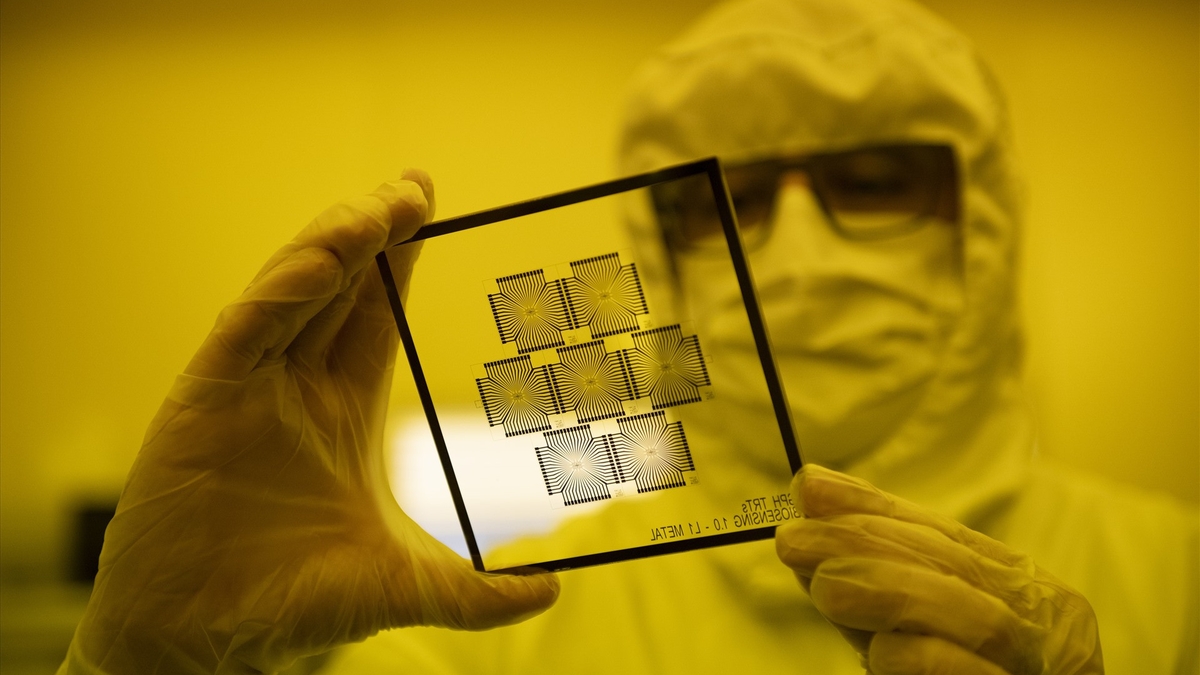
































![[Foto] Da Nang: Hunderte Menschen helfen nach Sturm Nr. 13 bei der Reinigung einer wichtigen Touristenroute.](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/07/1762491638903_image-3-1353-jpg.webp)













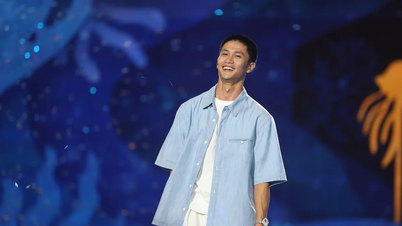






























































Kommentar (0)