In der nationalen Entwicklungsstrategie spielt die Berufsbildung , insbesondere die Hochschulen, eine Schlüsselrolle bei der Bereitstellung hochqualifizierter Fachkräfte. Die Festlegung von Standards für die Schulgründung ist notwendig, um Qualität und Systemorientierung zu gewährleisten. Im Kontext der staatlichen Bemühungen um eine Straffung des öffentlichen Apparats und die Förderung der Sozialisierung offenbart die Anwendung starrer Standards – insbesondere in Bezug auf Grundstücke und Kapital – jedoch zahlreiche Schwächen im privaten Sektor. Die Anwendung von Standards wie denen für öffentliche Schulen hat Engpässe geschaffen und die Entwicklung des gesamten Systems behindert.
„Einheitsgröße“ schafft Barrieren.
Die Bedeutung von Normen für die Festlegung von Qualitätsstandards und den Schutz von Lernenden ist unbestreitbar. Im öffentlichen Sektor, insbesondere bei Fusionen und Umstrukturierungen, tragen sie dazu bei, dass neue Einheiten effektiv arbeiten und öffentliche Ressourcen wie Grundstücke und Einrichtungen optimal genutzt werden. Sie sind ein notwendiges Managementinstrument zur Verbesserung der Effizienz der Nutzung öffentlicher Mittel und der Qualität von Bildungsdienstleistungen.
Die Anwendung derselben Standards – insbesondere hinsichtlich der Grundstücksfläche (20.000 m² in städtischen Gebieten, 40.000 m² außerhalb städtischer Gebiete) und des Investitionskapitals (100 Milliarden VND ohne Grundstück) – auf den Privatsektor gestaltet sich jedoch anders. Dieser Einheitsansatz schafft eine nahezu unüberwindbare Hürde. In Großstädten ist Bauland knapp und teuer, wodurch die Flächenanforderung unrealistisch wird. Das hohe Investitionskapital schließt zudem kleine und mittlere Investoren, gemeinnützige Organisationen oder Einzelpersonen aus, die in angemessenem Umfang spezialisierte, qualitativ hochwertige Schulen eröffnen möchten.
Gleichzeitig ermöglicht die Digitalisierung die Implementierung von E-Learning-Modellen, Blended Learning und virtuellen Laboren und reduziert so die Abhängigkeit von physischen Räumlichkeiten. Kooperative Trainingsmodelle mit Unternehmen, wie beispielsweise arbeitsplatzbasiertes Lernen (Work-Based Learning, WBL), nutzen die vorhandenen Einrichtungen effektiv. Das Festhalten an der traditionellen Schularchitektur – die große Campusgelände und umfangreiche Infrastruktur erfordert – ist überholt und verpasst die Chance, flexiblere und kostengünstigere Trainingsmethoden zu nutzen. Dies führt dazu, dass der Privatsektor gebremst wird, was der Sozialisierungspolitik widerspricht und die Deckung des Personalbedarfs des Landes verlangsamt.

Die traditionelle Denkweise bei der Schulplanung – die große Campusgelände und eine umfangreiche Infrastruktur erfordert – ist überholt.
FOTO: ILLUSTRATION VON KI
Internationale Erfahrungen zeigen, dass viele Länder einen flexibleren Ansatz verfolgen. In Australien verlangt die Australian Skills Quality Authority (ASQA) von den Einrichtungen der beruflichen Aus- und Weiterbildung (TVET), dass sie über ausreichende Ressourcen (finanziell und materiell) verfügen, die dem Umfang ihrer registrierten Tätigkeiten entsprechen, anstatt einen festen Bereich vorzuschreiben. Im Vereinigten Königreich konzentriert sich das Office for Students (OfS) in einem spezifischen Kontext auf die Qualität der Ausbildungsergebnisse sowie die administrative und finanzielle Kapazität. Auch das Akkreditierungssystem in den USA legt keinen absoluten Bereich fest, sondern bewertet die Angemessenheit und Eignung der Ressourcen für das jeweilige Ausbildungsprogramm. Der allgemeine Trend geht weg von der Inputkontrolle hin zur Bewertung der Umsetzungskapazität und der Qualitätskontrolle der Ausbildungsergebnisse.
Flexible Eingangsgröße gepaart mit strenger Kontrolle der Ausgangsqualität
Aus Sicht kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) sollte Vietnam einen neuen Ansatz für die Lizenzierung der Gründung privater Hochschulen in Betracht ziehen. Anstatt einheitliche Hürden zu setzen, sollten flexible Standards entwickelt werden, die sich nach Ausbildungsumfang und Fachrichtung/Branche richten. Das Kernprinzip lautet: „Zweckmäßigkeit“. Die Rolle des Staates sollte sich von der Kontrolle der Produktionsfaktoren hin zur Festlegung von Mindeststandards verlagern, bei gleichzeitiger Stärkung der Ergebniskontrolle.
Diese Mindeststandards sollten sich auf Faktoren konzentrieren, die die Qualität der Lehre unmittelbar beeinflussen: Lern- und Übungsräume pro Studierendem; die notwendige Ausstattung für den jeweiligen Studiengang; und ausreichende finanzielle Mittel für einen stabilen Betrieb (beispielsweise durch einen Businessplan, Bürgschaften oder entsprechendes Kapital). Eine Hochschule für Informationstechnologie mit 300 Studierenden benötigt selbstverständlich nicht dieselben Ressourcen wie eine Hochschule für Maschinenbau mit 3.000 Studierenden. Dieser Ansatz ermöglicht Vielfalt und fördert spezialisierte Modelle – klein, aber qualitativ hochwertig.
Flexibilität bei den Inputfaktoren muss jedoch mit einer strengeren Kontrolle der Outputqualität einhergehen – eine Grundvoraussetzung. Die Aufgabe des Staates besteht darin, ein effektives System zur Überprüfung der Ergebnisse aufzubauen und zu betreiben. Dieses umfasst: die unabhängige Akkreditierung von Ausbildungsprogrammen und -einrichtungen; die Bewertung der tatsächlichen Kompetenzen der Absolventen; die Überwachung und Veröffentlichung von Beschäftigungsquoten, Gehältern und der Zufriedenheit der Unternehmen; sowie die Verhängung strenger Sanktionen – bis hin zum Lizenzentzug – gegen Einrichtungen, die die Standards nicht erfüllen. Transparenz bei den Akkreditierungsinformationen hilft Lernenden und der Gesellschaft zudem, die richtige Wahl zu treffen.
Um die Entwicklung der Berufsbildung, insbesondere im privaten Sektor, nachhaltig zu fördern, müssen die institutionellen Hürden bei den Gründungsbedingungen abgebaut werden. Der Ansatz der einheitlichen Standards sollte durch ein flexibles, nach Größe und Branche (z. B. KMU) klassifiziertes Modell ersetzt werden, das sich auf die wesentlichen Mindestbedingungen und die Eignung konzentriert. Entscheidend ist, dass dieser Wandel von einem starken, effektiven und transparenten System zur Qualitätssicherung begleitet wird. Nur so lassen sich gesellschaftliche Potenziale freisetzen und die Qualität der Humanressourcen sichern und kontinuierlich verbessern – für ein dynamisches, vielfältiges Berufsbildungssystem, das den Entwicklungsbedürfnissen des Landes entspricht.
Im Kontext der Gesetzesänderung über die Berufsbildung durch das Ministerium für Bildung und Ausbildung ist eine umfassende institutionelle Bewertung und Reform dringend erforderlich, um die sozialen Ressourcen bei der Ausbildung hochqualifizierter Fachkräfte effektiv zu fördern.
Quelle: https://thanhnien.vn/thao-nut-that-the-che-de-phat-trien-truong-cao-dang-tu-thuc-185250807191437627.htm


![[Foto] Panorama der Finalrunde der Community Action Awards 2025](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/15/1763206932975_chi-7868-jpg.webp)
![[Foto] Premierminister Pham Minh Chinh trifft sich mit Vertretern herausragender Lehrer](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/15/1763215934276_dsc-0578-jpg.webp)
![[Foto] Generalsekretär To Lam empfängt Vizepräsident der Luxshare-ICT-Gruppe (China)](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/15/1763211137119_a1-bnd-7809-8939-jpg.webp)
















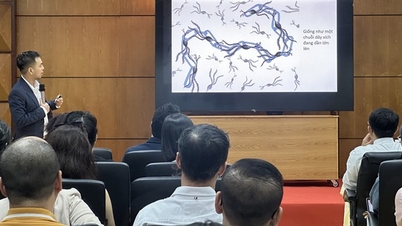

















































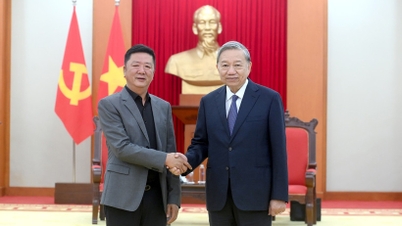







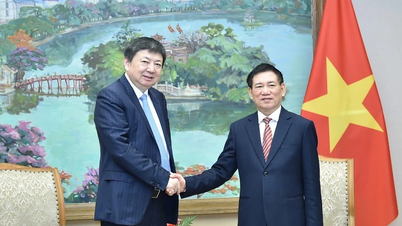





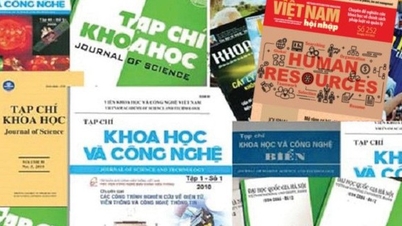
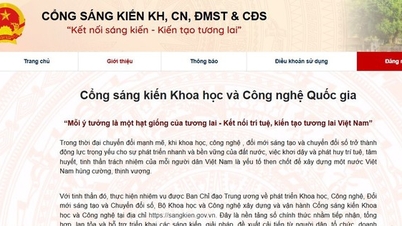



















Kommentar (0)